2 Kommentare
Die Türen zum Dialog offen halten
Die Gewalteskalation in Nahost fordert unzählige Opfer. Bei der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen, aber auch bei den Jüdinnen und Juden, nicht nur in Israel, sondern weltweit. Denn der Antisemitismus nimmt stark zu. Auch in der Schweiz ist es zu zahlreichen Vorfällen gekommen. Wie erleben das die Jüdinnen und Juden in der Ostschweiz? Und wie gehen sie mit der Situation in Nahost um?

Illustration: Anna Albisetti
Der Antisemitismus hat mit der Eskalation in Nahost zugenommen. In Frankreich, wo die grösste jüdische Gemeinschaft Europas lebt, ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle regelrecht explodiert, auch in England und in Deutschland hat sie stark zugenommen. Er ist nicht nur für die Jüdinnen und Juden unmittelbar spürbar, sondern für alle sichtbar – auch hierzulande.
Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) teilte zwei Wochen nach dem Angriff der Hamas der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, ihm seien in dieser Zeit – ohne Äusserungen im Internet – in der Deutschschweiz 26 Fälle von Antisemitismus gemeldet worden, so viele wie sonst in einem halben Jahr: Tätlichkeiten, Beschimpfungen auf offener Strasse, in Briefen oder E-Mails, Schmierereien, aber auch judenfeindliche Plakate an Demonstrationen.
Während Solidaritätsaktionen für die israelischen Opfer des Hamas-Angriffs weitestgehend ausblieben, ist an vielen Kundgebungen für den Frieden im Gazastreifen seither unter anderem «From the river to the sea, Palestine will be free» zu hören, ein Slogan, der Israel das Existenzrecht abspricht und die vollständige Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus ihrer Heimat impliziert. In Zürich etwa wurden Wohnhäuser mit «Achtung Juden» und dem Davidstern verschmiert, an einer Wand war «Tot [sic!] den Juden» zu lesen. Es sind Bilder, die an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern.
Viele Jüdinnen und Juden haben wieder Angst, ihre Herkunft öffentlich zu zeigen und beispielsweise eine Halskette mit dem Davidstern offen zu tragen. Doch wie erleben Jüdinnen und Juden in der Ostschweiz den zunehmenden Antisemitismus? Spüren sie ihn, und wenn ja, wie und in welcher Intensität äussert er sich? Und wie gehen sie mit allfälligen Anfeindungen um?
Ende Oktober trifft Saiten den St.Galler Rabbiner Shlomo Tikochinski und Roland Richter, Vizepräsident der Jüdischen Gemeinde St.Gallen, zum Gespräch. Auch dreieinhalb Wochen nach den Angriffen der Hamas sind sie noch aufgewühlt. Beide haben nahe Familienangehörige in Israel. Und beiden fällt es nach wie vor schwer, die Geschehnisse der vergangenen Wochen irgendwie einzuordnen und zu verstehen.
Schmierereien an der Synagoge, Beschimpfungen oder gar Übergriffe hätten sie hier glücklicherweise nicht erlebt, sagen Richter und Tikochinski. Was aber nicht heisst, dass die jüdische Gemeinschaft die antisemitische Stimmung nicht spüren würde. Auch aus diesen Gründen hat die Gemeinde ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. «Ich persönlich fühle mich hier sicher», sagt Tikochinski. Verschiedene Leute – die meisten davon Christ:innen – hätten sich nach den Anschlägen der Hamas bei ihm gemeldet und Mut und Hoffnung gespendet. Vom St.Galler Pfarrer Matthias Wenk habe er sogar auf der Strasse den Segen bekommen. «Ich fühle mich umarmt.» Und dennoch: Wenn er draussen unterwegs ist, legt der Rabbi die Kippa ab und trägt stattdessen einen Hut.
«Der Antisemitismus ist wie ein Seismograf», sagt Richter. Solange es einer Gesellschaft gut gehe, spüre man ihn praktisch nicht. «Doch sobald es eine Häufung von negativen Befindlichkeiten gibt, sieht man seine Ausschläge.» Mit anderen Worten: Der Antisemitismus ist allgegenwärtig, nur nicht immer in gleichem Ausmass spürbar. Dass er nun wieder aufflammt, veranschaulicht letztlich nur, wie tief er in der Gesellschaft verwurzelt ist. Das zeigte sich schon bei der Coronapandemie. Damals verbreiteten sich die krudesten Theorien, die hinter der Pandemie eine jüdische Verschwörung vermuteten. Auch dies veranlasste 2021 die EU, Massnahmen gegen die Bekämpfung des Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens zu beschliessen.
Eine jahrhundertealte Tradition
«Wir müssen davon ausgehen, dass der Antisemitismus eine Tradition hat, die mehr als 2000 Jahre zurück geht», sagt Richter. Die katholische Kirche – die grösste Macht, die es damals gab – habe ihn mit dem 3. Laterankonzil von 1179 und insbesondere mit dem 4. Laterankonzil von 1215 formalisiert. In letzterem habe sie «eine Reihe von antijüdischen Dekreten erlassen, die den Vergleich mit den Nürnberger Rassengesetzen von 1935 nicht zu scheuen brauchen».
Damals wurde etwa festgelegt, dass Jüdinnen und Juden keine öffentlichen Ämter bekleiden dürfen, um keine Machtbefugnisse über Christ:innen zu haben, oder dass sie sich anders kleiden sollen, damit christliche und jüdische Männer und Frauen «sich nicht irrtümlich miteinander einlassen». Dasselbe galt übrigens auch für die Muslime. Auch deshalb gehöre der Antisemitismus heute, wie es die Geisteswissenschaftler:innen Jan und Aleida Assmann formuliert hatten, zum «kulturellen Gedächtnis Europas», sagt Richter. «Neu ist, dass wir in Bezug auf die antijüdische Haltung überall auf der Welt Brandherde sehen. Das muss uns beunruhigen, und damit wir hier funktionieren können, müssen wir unsere persönlichen Schutzmassnahmen ergreifen.» Dazu gehört für Richter auch, nicht rund um die Uhr Nachrichten zu konsumieren. «Die Unruhe, die in mir herrscht, reicht mir. Ich muss sie nicht noch künstlich stimulieren.»
Auch Richter ist vorsichtig, wenn es um seine Religionszugehörigkeit geht. Er zitiert den ehemaligen St.Galler Rabbiner Hermann Schmelzer (mehr zu ihm auf Seite 39 im Dezemberheft): «Bedenke, zu wem du sprichst.» Je nachdem, in welcher Gesellschaft er sei, verhalte er sich anders. «Ein Prinzip ist: Ich setze mich nicht an den Biertisch mit jemandem, den ich nicht kenne, weil ich nicht Dinge hören möchte, die mit zunehmendem Alkoholpegel da gesagt werden.» Sogar in seinem engsten Freundeskreis – fünf Ehepaare, die sich seit mehr als 30 Jahren mehrmals jährlich treffen – bekomme er gelegentlich unterschwellig antisemitische Ressentiments zu hören oder zu spüren. «Das fängt damit an, dass man mich mit Israel identifiziert, obwohl ich als Schweizer in St.Gallen aufgewachsen bin.» Während ihn einige seiner Freunde seit dem Ausbruch des Konflikts regelmässig kontaktierten, hätten sich andere spürbar stiller verhalten.
Zur Lösung gerade solcher Konflikte, bei denen auch Spannungen aufgrund des Glaubens mitschwingen, ist der interreligiöse Austausch beziehungsweise eine klare gemeinsame Positionierung der Exponent:innen der verschiedenen Religionen gegen Gewalt und Zerstörung äusserst wichtig. Denn die Welt lässt sich auch im Kleinen besser machen. Dort beginnt fast jede Veränderung.
Am Runden Tisch der Religionen St.Gallen und Umgebung versammeln sich vier- bis fünfmal pro Jahr Vertreter:innen verschiedener Kirchen (Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus und Bahaitum). Am Treffen im Oktober, wenige Tage nach den Angriffen der Hamas, habe eine gedämpfte Stimmung geherrscht, erzählt Tikochinski. Alle hätten sich sehr vorsichtig ausgedrückt, sie hätten «nur über die Menschheit und Gefühle gesprochen, nicht über Politik. Aber alles ist Politik.» Nach dem Gespräch und dem gemeinsamen Gebet, bei dem alle zu ihrer jeweiligen Gottheit sprachen, hatte der Rabbiner plötzlich eine Idee: Mit einer jungen Palästinenserin, die als Vertreterin des Islam am Treffen anwesend war, habe er gebetet – auf Arabisch, die erste Sure des Korans. Ein starkes Zeichen, gewiss, aber ohne öffentliche Wahrnehmung. Auch andere interreligiöse Botschaften hat man bisher kaum vernommen. Ausserhalb des Runden Tisches der Religionen stehe er nicht im Kontakt mit hiesigen Vertretern des Islam, sagt Tikochinski. Warum nicht? Es bleibt unklar.
Saiten hätte gerne auch mit dem Imam der Islamischen Gemeinschaft El-Hidaje St.Gallen gesprochen, doch deren Vorstand lehnte die Anfrage ab. Es handle sich um «ein sensibles Thema», ausserdem sollte die Institution «vor verschiedenen Risiken und die dadurch entstehenden Missverständnisse und Fehlinterpretationen» geschützt werden. «Unsere Gemeinde lehnt jegliche Form von Gewalt ab und steht für den Frieden für beide Völker», teilte der Vorstand von El-Hidaje mit.
Die Hoffnung nicht verlieren
Michaella Guez, Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde St.Gallen, plädiert für einen interreligiösen Austausch, der bereits in der Grundschule beginne. «Jede Religion hat eine Macht», sagt sie. Schulkinder sollten im Religionsunterricht nicht nur die Bibel lesen, sondern beispielsweise auch den Koran kennenlernen. Man könnte auch gemeinsame Feste der Religionen feiern. Dadurch würde das Verständnis für andere Glaubensrichtungen früh gefördert. Für sie sei es jedenfalls unverständlich, dass in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft Menschen aufgrund ihrer Religion ausgegrenzt oder gar verachtet würden.
Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern wohnt inzwischen seit mehr als 30 Jahren in der Schweiz. Sie kam als Kind eines jüdischen Ehepaars im tunesischen Bizerta zur Welt. Als sie zwei Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern und den Geschwistern nach Aschdod in Israel, eine Hafenstadt am Mittelmeer, südlich von Tel Aviv. In Israel sei sie mit Antisemitismus nie in Berührung gekommen, das Wort habe sie lediglich aus dem Geschichtsunterricht gekannt. Erst als sie mit gut 30 mit ihrem Mann in die Schweiz gekommen sei, habe sie den Antisemitismus «auf einer persönlichen Ebene» zu spüren bekommen, wie sie sagt. Mit explizitem Judenhass sei sie jedoch nie direkt konfrontiert gewesen, auch in jüngster Zeit nicht. Sie fühle sich deshalb auch nicht unwohl. Sie meide aber bewusst den Kontakt zu Menschen oder Gruppen, die ihn potenziell äussern könnten.
Guez engagiert sich in verschiedenen Projekten in Israel. Sie unterstützt ein Programm, das finanziell benachteiligten Student:innen aus Ashdod Stipendien zuspricht. Nach den Angriffen der Hamas hat sie zusätzliches Geld gesammelt, um diese Beiträge zu erhöhen. Hoffnung auf eine Zukunft statt Aussicht auf Zerstörung – «das ist meine Rache an diesem Krieg». Sie hilft dem Schweizer Kinderdorf Kiriat Yearim in der Nähe von Jerusalem, wo jüdische und muslimische Kinder wohnen. Sie ist aber auch hier tätig: Als im Arabischen Frühling eine Gruppe von 40 Geflüchteten aus Syrien nach St.Gallen gekommen sei, hätten sich ein paar Frauen aus der Jüdischen Gemeinde um ihr Wohl gekümmert. «Vielleicht ist das naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, jemanden aufgrund der Religion zu verurteilen, zumal wir unsere Religion ja nicht einmal ausgewählt haben.»
Die Gewalteskalation habe in ihr eine tiefe Trauer ausgelöst, sagt Guez. Seither betet sie noch öfter als sonst. «Manchmal geht es auch nicht, ich finde dann einfach keine Verbindung.» Sie nimmt auch am Runden Tisch der Religionen teil. An der Sitzung wenige Tage nach dem Angriff der Hamas hätten die Beteiligten entschieden, jeden Mittwoch zwischen 18 und 21 Uhr zu beten – jede und jeder für sich, aber irgendwie doch gemeinsam. «Das ist schön.» Auch daraus schöpft sie Kraft. Denn sie verarbeite immer noch die Geschehnisse vom 7. Oktober, erzählt sie rund einen Monat später. «Ein Haus kann man schnell wieder aufbauen. Aber die Seele braucht länger.»
Durch die Angriffe der Hamas sei in ihr, aber vermutlich auch bei vielen anderen Menschen in Israel, eine Basis menschlichen Vertrauens kaputtgegangen, sagt Guez. Nach dem Osloer Friedensprozess Mitte der 90er-Jahre habe sie Optimismus verspürt, dass es eine Lösung für einen dauerhaften Frieden geben könne. Diese Bemühungen seien nun erneut um Jahrzehnte, ja «um 100 Jahre» zurückgeworfen worden.
Ob man ihren Optimismus spüre, fragt Michaella Guez zum Schluss des Gesprächs. Denn eigentlich sei sie ein sehr zuversichtlicher Mensch, und am 7. Oktober habe sie noch gedacht, auch die Angriffe der Hamas könnten ihr ihren Optimismus nicht nehmen. Jetzt spüre sie aber einen «Miniriss». «Ich möchte meine Hoffnung auf eine Lösung, auf dauerhaften Frieden nicht verlieren. Was bleibt mir denn sonst?»
In der Schule mit eigener Identität konfrontiert
Samira (Name geändert) ist Anfang 30 und in der Region St.Gallen geboren und aufgewachsen. Sie gibt sich ungern als Jüdin zu erkennen, nicht zuletzt wegen der negativen Erfahrungen, die sie schon früher aufgrund ihrer religiösen Herkunft erlebt hat. Überhaupt hält sie den Kreis der Personen, die von ihrer Herkunft wissen, sehr eng. Deshalb möchte sie auch ihren richtigen Namen nicht bekanntgeben. Seit dem 7. Oktober ist sie noch vorsichtiger geworden. Wenn sie in der Öffentlichkeit mit ihrer Mutter telefoniert, wechselt sie von Hebräisch auf Deutsch. Aus reinem Selbstschutz. Das allein zeigt ein generelles Problem auf: Jüdinnen und Juden müssen sich Gedanken um ihre Sicherheit machen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zu erkennen geben.
Samira arbeitet als Lehrerin auf der Oberstufe. Sie ist eine offene Person, spricht mit ihren Schüler:innen auch über Persönliches, gerade in Einzelgesprächen. Dass sie Jüdin ist, hat sie auch ihnen verschwiegen. «Ich weiss nicht, welche Türen das öffnen würde. Und ich will nicht, dass es an meinem Arbeitsplatz zum Thema wird, wie es damals für mich in der Schule ein Thema war.»
Ihre ersten Erfahrungen mit Antisemitismus machte Samira in der Kanti. Ihr war bewusst, dass sie anders aussah und dass die Familie an Weihnachten keinen Baum hatte. Doch als das Judentum im Unterricht behandelt wurde, sei unter den Mitschüler:innen plötzlich auch ihre Herkunft zum Thema geworden, auch über ihre Klasse hinaus – und für sie selbst. Ihre Kolleg:innen zogen sie mit Judenwitzen auf, nicht bösartig. «Ich habe kein grosses Ding daraus gemacht, weil ich mich bis dahin selber gar nicht gross mit dem Judentum und mit meinem Jüdischsein auseinandergesetzt hatte. Ich wusste nicht einmal, was das für mich bedeutet. Ich war Jüdin, weil es meine Eltern waren», erzählt sie. Für sie war es schwierig einzuordnen, über welche Witze sie selbst lachen konnte. Und es blieb nicht bei den Witzen. Einmal habe ein Schüler aus der Parallelklasse im Vorbeilaufen den Hitlergruss gezeigt.
Die Teenagerin begann, sich mit ihrem Jüdischsein auseinanderzusetzen – allein. «Die Situation wurde sehr belastend für mich. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Nicht mit den Eltern, nicht mit den Freundinnen», sagt Samira. Sie dachte, das sei eine Phase und gehe umso schneller vorbei, je weniger sie es beachte. Doch als Folge dieser Selbstreflexion, aber auch aufgrund von Aussagen wie «geh doch zurück nach Israel» hätten sich ihr plötzlich Identitätsfragen gestellt. «Bin ich eine Ausländerin? Oder gehöre ich hierher?» Erst viel später sei ihr klar geworden, dass sie nicht etwas Bestimmtes sein müsse. Nicht Israelin, nicht Schweizerin, nicht Jüdin. «All diese kulturellen Hintergründe sind ein Teil von mir.»
Auch ihr Verhältnis zum jüdischen Glauben musste Samira erst einmal für sich klären. «Ich unterscheide zwischen spirituell und religiös. Ich halte mich an gewisse Regeln und praktiziere bestimmte Bräuche wie das Fasten an Yom Kippur, allein schon aus gesundheitlichen Gründen. Als ich noch Fleisch ass, verzichtete ich auf Schweinefleisch. Aber ich lebe nicht nach der Religion, was Kleider, Ernährung oder anderes betrifft», erzählt sie.
Samira spricht sehr überlegt, präzis, wählt jedes ihrer Worte mit Bedacht. Dennoch ist sie äusserst vorsichtig damit, andere für antisemitische Äusserungen vorschnell zu verurteilen. «Ist jemand, der sich abschätzig über Juden äussert, automatisch ein Antisemit? Oder ist ihm die Tragweite seiner Äusserung einfach nicht bewusst?», fragt sie. Deshalb plädiert sie für Zurückhaltung bei der Reaktion auf eine solche Äusserung. «Wenn ich die betreffende Person gleich als antisemitisch abstemple, schlage ich die Türe zum Dialog zu.»
Dem Krieg in Nahost begegnet Samira mit grosser Ablehnung. Sie verurteilt die Angriffe der Hamas auf Israel aufs Schärfste, es ist der einzige Moment im Gespräch, bei dem ihr die Worte fehlen. Sie hält aber auch die Politik der israelischen Regierung und den Gegenangriff für falsch. Verteidigung sei legitim, aber wo fange Verteidigung an, wo werde sie zur Rache? Die militärische Antwort Israels sei in dieser Form jedenfalls nicht zielführend. «Man kann eine Ideologie wie die der Hamas nicht mit Gewalt auslöschen. Man stärkt sie dadurch nur. Das sieht man letztlich auch an diesen Sympathiebekundungen in ganz Europa.» Auch deshalb fühle sie sich hilflos, ohnmächtig. Aber tatenlos zuschauen sei keine Option, sagt Samira: «Was den Krieg betrifft, kann ich von hier aus nichts bewirken. Aber ich – jede und jeder von uns – kann im direkten Umfeld etwas bewirken. Man kann nur versuchen, in dem kleinen Kreis, in dem man sich bewegt, so nett, hilfsbereit und offenherzig zu sein, wie man kann.»
Dieser Beitrag erschien im Dezemberheft von Saiten.





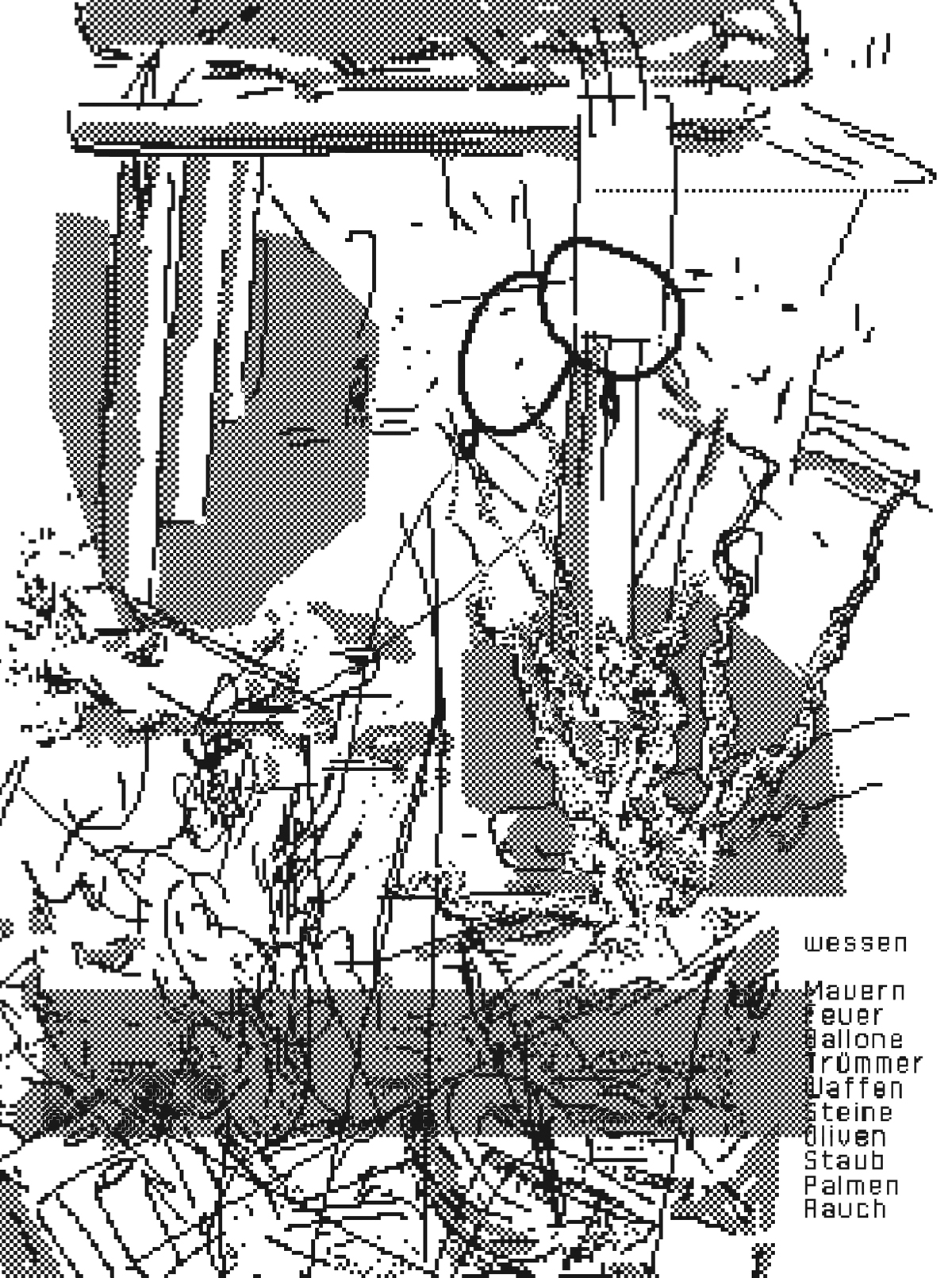
Danke für diesen differenzierten Beitrag.
Hoffnungslektüre und eindrücklicher Aufruf zur Versöhnung „Apeirogon“, Colum McCann,Rowohlt, 2020.